Moabit 1894 – Die Stephanstraße
Wir dokumentieren einen Text, in dem Otto von Leixner die Moabiter Stephanstraße beschreibt. Über die Intention des Autors sagt schon der Titel seines 1894 in Berlin erschienenen Buches „Soziale Briefe aus Berlin, mit besonderer Berücksichtigung der sozialdemokratischen Strömungen“ einiges aus. Sein Blick ist einerseits ein wenig sozialromantisch eingefärbt, neben echter Anteilnahme schwingt aber auch bürgerliche Überheblichkeit mit. Im Rahmen von „Moabit liest!“ haben wir diesen Text und weitere historisch journalistische Texte im B-Laden vorgelesen. Die alte Rechtschreibung wurde beibehalten.
„Wer nicht Weltstädter vom Wirbel bis zur Sohle ist und zum Leben elektrisches Licht, Menschengetriebe, glänzende Schauläden und die Aufregungen der Gesellschaftelei nötig hat, den zieht es oft nach den stilleren Teilen Berlins. Langsam verhallt dann hinter ihm das Gebrause, die Straßen werden stiller, ihre Beleuchtung weniger aufdringlich, zuweilen für das gesteigerte Bedürfnis fast unzureichend. Man glaubt sich in eine andere Welt versetzt. Ein Bild aus ihr will ich den Lesern vorführen.
Eine Vorstadtstraße. Aber keine der alten Stadtteile. Sie ist in den letzten vier, fünf Jahren entstanden und manche Häuser sind noch im Adreßbuch von 1890 als unbewohnt angegeben, trotzdem sie in den letzten zwei Monaten des ersten Halbjahrs sich bis unters Dach mit Mietern gefüllt haben. Andere sind noch nicht bezogen. Die Straße liegt im Nordwesten in jenem Teile, der sich von Alt-Moabit aus in der Richtung nach Plötzensee gebildet hat. Vor etwa zehn Jahren noch zumeist eine kleine Sandbüchse, ist es jetzt eine der größten Vorstädte und zugleich eine der gesundesten von ganz Berlin. In den meisten Straßen sind gleich bei der Anlage des Netzes Bäume angepflanzt worden, die sorgfältig gepflegt werden und trotz der schädlichen Einflüsse der Gasleitungen recht gut fortkommen. Linden überwiegen, doch finden sich auch Ahorn- und Birkenbäume. Das giebt im Vereine mit den kleinen Vorgärten manchen Straßen ein sehr freundliches Gepräge.
 In den Häusern hat die Baukunst nicht grade Siege gefeiert, wenigstens nicht was die Ausbildung der Stirnseite betrifft. Man freut sich, wenn der Baumeister sich begnügt hat, seinen vier- oder fünf Stock hohen Kasten einfach hinzustellen und auf jeden weitern Schmuck, als auf schlichte vorgeschobene Erker und einfache Balkone zu verzichten. Dort aber , wo er seiner Einbildungskraft die Zügel hat schießen lassen, sind schauerliche Kunstwerke entstanden. Erstes und zweites Stockwerk bis auf schwächliche Pilaster ganz flach; im dritten springt plötzlich ein wuchtiger Balkon hervor, der für zwei Mieter bestimmt ist und von kühn geschwungenen Voluten, die aus dem Bewurf, weiß Gott wie, herauswachsen, getragen wird. Auf dem Balkon entwickeln sich vier Pfeiler mit allerlei Schnörkeln überladen und gehen in schmalbrüstige Atlanten über, die nun dicke Säulen tragen müssen. Auf diesen stehen vier von den dutzendweise hergestellten Kanephoren und strecken die Hände hilfeflehend gegen das auf ihnen lastende Dach. Im vierten Stockwerke sind noch zwischen den Säulen drei Balkone eingequetscht, die ganz und gar Kanzeln gleichen. Ein Mensch und ein Rosenstock, mehr hat auf ihnen nicht Platz. Wenn man sich so ein Haus längere Zeit betrachtet, bekommt man einen Fieberanfall und redet irre; die Tollheit steckt eben an.
In den Häusern hat die Baukunst nicht grade Siege gefeiert, wenigstens nicht was die Ausbildung der Stirnseite betrifft. Man freut sich, wenn der Baumeister sich begnügt hat, seinen vier- oder fünf Stock hohen Kasten einfach hinzustellen und auf jeden weitern Schmuck, als auf schlichte vorgeschobene Erker und einfache Balkone zu verzichten. Dort aber , wo er seiner Einbildungskraft die Zügel hat schießen lassen, sind schauerliche Kunstwerke entstanden. Erstes und zweites Stockwerk bis auf schwächliche Pilaster ganz flach; im dritten springt plötzlich ein wuchtiger Balkon hervor, der für zwei Mieter bestimmt ist und von kühn geschwungenen Voluten, die aus dem Bewurf, weiß Gott wie, herauswachsen, getragen wird. Auf dem Balkon entwickeln sich vier Pfeiler mit allerlei Schnörkeln überladen und gehen in schmalbrüstige Atlanten über, die nun dicke Säulen tragen müssen. Auf diesen stehen vier von den dutzendweise hergestellten Kanephoren und strecken die Hände hilfeflehend gegen das auf ihnen lastende Dach. Im vierten Stockwerke sind noch zwischen den Säulen drei Balkone eingequetscht, die ganz und gar Kanzeln gleichen. Ein Mensch und ein Rosenstock, mehr hat auf ihnen nicht Platz. Wenn man sich so ein Haus längere Zeit betrachtet, bekommt man einen Fieberanfall und redet irre; die Tollheit steckt eben an.
Eine Art billiger Luxus ist in den Wohnungen der untern Stockwerke der Vorderhäuser fast überall zu finden. Es wird ja alles im Großen und aus schlechterm Stoff hergestellt und ahmt wirklichen Reichtum nach. Die Thüren tragen Supraporten, aus Holzstoff gepreßt, die Blattranken und Eierstäbe vergoldet. Die Decken zeigen Stuck, der meterweise gekauft und mit Schrauben befestigt wird. Verzeichnete Engel und Fabeltiere, erstere mit knallroten Backen und großen Vergißmeinnichtaugen, schweben oben in den verzwicktesten Stellungen herum. Es verschlägt nichts, wenn dann ein langer Zapfen, in den das Gasrohr für einen Kronleuchter mündet, aus dem Bauche irgendeines Himmelbewohners heraushängt. Die meisten Stockwerke enthalten zwei Wohnungen von 3 bis 4 Zimmern, Küche, und jetzt auch meistens Badestube. Das Wort „Stube“ ist allerdings mit Vorsicht aufzunehmen, denn neben der Wanne hat nichts anderes Platz; zuweilen in ihr auch nur sehr schlank gebaute Menschenkinder. Aber immerhin ist das schon ein großer Fortschritt, den man der neuesten Zeit verdankt.
Die Preise dieser Wohnungen schwanken zwischen 600 bis 850 Mark [Anm. das waren Jahresmieten!]. In dem 4. und 5. Stock ist derselbe Raum oft zu drei Wohnungen verwendet. Im Verhältnis zu den „feinen“ Vierteln kann man in diesem Stadtviertel um 20 bis 50 Prozent billiger wohnen. Am geringsten ist der Preisunterschied bei den ganz kleinen Wohnungen, die zumeist in die Hinterhäuser verlegt sind. Die Straße gehört zu den stillen. Sie verbindet keine Adern größern Verkehrs, es ist auch kein Bahnhof in nächster Nähe, ebensowenig sind in ihr irgendwelche großen Betriebe. Auch die Pferdebahn überquert die Straße nur am Ende. Somit fällt auch das Gerolle und Geklingel fort.
Die Bewohner setzen sich aus verschiedenen Schichten zusammen, nur die obersten und untersten fehlen. Die besseren Wohnungen haben mittlere und kleine Beamte der Post, der Steuer oder der Stadt inne; daneben finden sich einige Offiziere im Ruhestand; kleinere Kaufleute, die den Tag über in der Stadt thätig sind; bescheidene Rentner; hier und da ein Schriftsteller oder Maler. Sehr stark sind Gewerbetreibende aller Art vertreten, deren Wohnungen neben den Läden im Erdgeschoß liegen. Den größten Teil der Bewohner bilden aber besser gestellte Arbeiter aller Zweige, Werkmeister, Monteure, Former u.s.w. Hier herrscht schon stark die Sozialdemokratie; noch mehr ist das jedoch auf dem benachbarten Wedding der Fall.
Die Läden der Straße dienen fast alle den nötigsten Lebensbedürfnissen. Gemüsehändler, Bäcker in großer Zahl, an mehreren Stellen Haus an Haus, Fleischer, Milchladen – großartig Milchbureau genannt -, daneben Zigarrenverkäufer, Bartscherer. Auffallend groß ist die Menge der kleinen Kneipen, die fast alle im Schauladen die Büsten Kaiser Wilhelms II. zeigen, selbst diejenigen, in denen fast nur sozialdemokratische Arbeiter verkehren. Leider überwiegen Schnapsläden, und die weibliche Bedienung, diese Pest Berlins, ist in einigen Schankstätten auch hier zu finden.
In dem Häuserstock, der von 32 Wohngebäuden gebildet ist und seine Hypotenuse in der besprochenen Straße hat, zähle ich nicht weniger als 23 Schankstätten, darunter sieben, in denen nur Branntwein verkauft wird. An mehrern Stellen befinden sich Trinkstätten Haus an Haus, einmal zwei in demselben Gebäude, rechts und links vom Thorwege.
Das Straßenleben, obwohl an Buntheit nicht mit jenem in den Hauptadern des Verkehrs zu vergleichen ist doch eigenartig. Und zwar spielen die Kinder darin die größte Rolle.
In der Straße selbst liegt eine Volksschule, ein sehr großer Rohziegelbau. Die Schulkinder haben zu verschiedenen Stunden Unterricht und rücken in Abteilungen an. Sie machen, was das Äußere betrifft, fast durchweg einen guten Eindruck. Sehr selten sieht man eins, dem die Not auf das Antlitz ihre unverkennbaren Zeichen eingeschrieben hat; meist sind sie rotbackig und hinreichend genährt, nicht selten ebenso frisch, wie es etwa die Kinder in kleinen Städten oder auf dem Lande sind. Die Kleidung weist oft Spuren von Ärmlichkeit auf, aber die Kleider sind nie zerrissen, ebensowenig die Strümpfe und Schuhe. Nur die Kopfbedeckung fehlt im Sommer bei vielen Knaben und bei allen Mädchen. Es wird von der Schulbehörde ein sehr wohlthätiger Zwang ausgeübt, denn die Kinder dürfen weder mit zerrissenen unsauberen Kleidern, noch ohne Beschuhung in den Unterricht kommen. Die letztere ist nicht immer beliebt. Beim Verlassen des Schulgebäudes ziehen manche Knaben Strümpfe und Schuhe aus – ich dachte zuerst, es geschähe aus Sparsamkeit. Aber der Hauptgrund ist doch ein anderer. Zuweilen kommen die Sprengwagen zu der Zeit, wo eine Abteilung entlassen wird. Da krempeln sich die Jungen die Beinkleider so hoch, wie es nur geht, und nehmen, hinter den Wagen schreitend, eine Art von Regenbad, indem sie in stetem Wechsel ein Bein nach dem andern von den Wasserstrahlen besprengen lassen; mancher hält sogar den Kopf unter den Sprühregen. An der Thatsache der Abkühlung zweifle ich nicht, aber ob diese Art der Waschung die Reinlichkeit sonderlich fördere, ist mir fraglich.
Um die Mittagszeit, etwa 12 bis 1, ist die Straße von Kindern freier, dann aber tauchen Blond- und Braunköpfe von 2 bis 13 Jahren aller Enden hervor. Wie schon bemerkt, ist der Verkehr kein großer, hier und da zeigen sich Lastwagen, zumeist aber nur solche Gefährte, die Nahrungsmittel bringen. Wägelchen der Gemüse- und Milchhändler, die Hundewagen der kleinen Kohlenverkäufer u.s.w. Droschken sind ziemlich spärliche, noch seltener fahren Privatwagen durch die Straße. So bildet sie einen einzigen großen Spielplatz. Die Menge der Kinder ist eine ungeheure. Eines Tages habe ich um 5 Uhr nachmittags auf einer Strecke, die von je 12 Häusern auf jeder Seite begrenzt wird, 218 gezählt. Auf dem Bürgersteig sitzen und rutschen die ganz kleinen umher, sodaß man sich hüten muß, nicht auf ein Händchen oder Füßchen zu treten. Auf dem Fahrdamm wird von den Jungen Ball gespielt, der überhaupt das beliebteste Spielzeug hier bildet. Auf den Randsteinen des Bürgersteigs sitzen die Mädchen von 5 bis 8 Jahren und spielen Schule; andernorts thun die Knaben dasselbe. Der Unterschied besteht darin, daß der Darsteller des männlichen Lehrers sein Hauptvergnügen im Hauen findet und der Unterricht sich zuletzt stets in eine allgemeine fröhliche Rauferei verwandelt. Wirkliche Rohheiten habe ich indes noch nie beobachtet. Wunderbares leisten die Knaben in der Erzeugung von Lauten aller Art. Kreischen, Schreien, Brüllen, Quietschen, Jauchzen und Johlen: alles liefern sie in gleicher Meisterschaft. Mancher Spiele tieferer Sinn ist mir bis heute Geheimnis geblieben. Die Jungen stehen in einer Gruppe beisammen und schreien oder brüllen, bis die Gesichter vor Anstrengung rot werden, dann stieben alle plötzlich auseinander. Aufgefallen ist mir, wie wenig die Knaben Soldaten spielen. Sehr selten sieht man einige Jungen mit Kindergewehren oder Blechsäbeln.
Den Höhepunkt erreicht das Vergnügen, wenn in der Straße Wasser- oder Gasröhren oder irgendwelche Leitungen gelegt werden, d.h. wenn nach dem Berliner Ausdruck „gebuddelt“ wird. Solche Arbeiten werden hier stets mit großer Sorgfalt, aber dennoch rasch erledigt. Immerhin kann es zuweilen einige Wochen dauern. In regelmäßiger Schichtung werden die Pflasterwürfel aufeinandergelegt und dann die Erde aufgeworfen. Und nun beginnen auch die Kinder zu „buddeln“ ih ihrer Art, und die Arbeiter, deren natürliche Gutmütigkeit sich am meisten den Kleinen gegenüber zeigt, legen selten Widerspruch ein, solange das Treiben nicht allzu arg wird. Sie wissen wohl auch, daß fast alle diese Kinder ihrem eigenen Stande angehören. Da tollen nun Jungen und Mädchen auf den Erdhaufen umher, bewerfen sich mit Erde, stürmen und verteidigen die Festungen. Andere sitzen still beisammen und backen Kuchen. Manche Mutter aus den Hinterhäusern, die einen nötigen Gang zu besorgen hat, setzt ihr eineinhalb- oder zweijähriges Kind unbesorgt an einen solchen Erdhaufen und überläßt es dem Schutzengel, oder ruft das nächstbeste spielende Mädchen heran mit der Bitte, „bisken ufzupassen“.
Der Winter ändert nichts an der Spiellust, er bringt nur andere Spiele in Aufnahme. Daß Rutschbahnen angelegt werden ist selbstverständlich. Aber noch beliebter sind kleine Schlitten. Ist der Schnee, der hier nicht so rasch entfernt wird, wie in den Hauptstraßen, etwas fester, so tummeln sich die Kinder mit Dutzenden ihrer Fuhrwerke auf dem breiten Damm umher. Mag die Kälte auch Hände, Nasen und Ohren röten, auf eins hat sie nicht den geringsten Einfluß: auf die Stimmen. Die frieren nicht ein. Ja mir scheint, als ob das Geschrei noch kräftiger im Winter, als im Sommer sei.
Ich kehre wieder zu diesem zurück. Kleine, kaum noch schulpflichtige Mädchen beaufsichtigen schon die ganz kleinen Geschwister, setzen sich mit ihnen in ein Eckchen an der Hausthüre oder auf die Stufe, die zu einem Laden führt. Manches Mütterchen dieser Art strickt an einem Strumpf, an dem die Länge zuweilen blau und der Fuß rot oder braun ist, und plappert dabei sehr würdevoll mit den Schützlingen, die mit einer Faust voll Erde sich eingehend beschäftigen oder beschaulich an eiuer Semmelkruste kauen. Mädchen und Knaben werden sehr früh zu Besorgungen herangezogen und gewinnen dadurch bald eine gewisse Sicherheit. Vier- bis fünfjährige Kinder gehen mit Töpfen und Körbchen, um Milch und Nahrungsmittel beizuholen; leider sieht man sie auch oft mit einer leeren Bierflasche in die Schnapsläden eintreten. Mehrmals habe ich sogar bemerkt, daß kleine Jungen dann in ein offenes Hausthor schlüpfen und rasch einen Schluck zu sich nahmen. Das ist wohl nicht Vererbung, sondern bloße Nachahmung der Gewohnheiten Erwachsener.
Wenn die Mittagsstunde kommt und mit ihr die Ruhezeit, verlassen die Rohrleger und Maurer die Arbeit. Einigen, die nicht allzufern wohnen, bringt die Frau das Mittagsbrot, oft im Geleite der Kinder. Da setzt sich der Vater, nachdem er den Topf oder die tiefe Schüssel ausgelöffelt hat, auf den Erdhaufen, das Kleinste auf dem Schoß, und die Mutter kauert daneben hin. Da hört man oft fröhliches Lachen und Plaudern – nichts verrät die Stimmung, die sonst in den Arbeiterkreisen vorhanden ist.
Wenn abends die Arbeiter die Straße verlassen haben, so sind die Kinder die einzigen Herren der Lage. Dann kriechen sie in die aufgestellten oder liegenden Röhren und in die noch offenbleibenden Schächte, in denen die Leitungen ausgeführt werden. Die Hitze des Tages ist allmählich gewichen, Fenster und Ladenthüren öffnen sich, die zumeist mit Epheu oder wilden Wein bezogenen Balkone sind von luftgierigen Menschen besetzt. Vor den Hausthüren sitzen plaudernde Männer und Frauen, manche sitzen auf Stühlen in den Thürnischen oder selbst auf den Bürgersteigen und stricken oder flicken. Das sind vor allem Bewohner der Hinterhäuser. Gegen 9 Uhr verschwinden die Kinder, um etwa 10 Uhr haben sich auch fast alle Erwachsenen zurückgezogen. Kaum daß noch hier und dort ein Fenster beleuchtet aus dem Dämmern aufzuckt, und hier und da ein Wagen oder der Schritt eines Fußgängers die Stille unterbricht. Offen sind nur mehr die Kneipen, aber auch aus ihnen tönt selten wüster Lärm, da sich in diesem Straßenteil ein Polizeibureau befindet. Man könnte glauben, sich in irgend einem kleinen Städtchen zu befinden; nichts verrät die Weltstadt. Nur aus einem verhüllten Laden fällt ein schmaler Lichtstreif auf die Straße, der selten vor Mitternacht erlischt. Es ist eine Plättanstalt. Dort arbeiten die angestellten Mädchen gewöhnlich von 7 1/2 morgens bis 11, 12 Uhr nachts, mit Abrechnung der Pausen mindestens 13 Stunden.
Länger als auf der Straße dauert zuweilen das Leben im Hofe. Die neue Bauordnung, nach der die meisten Häuser dieser Straße eingerichtet werden mußten, ist, soviel gegen sie auch gesprochen worden sein mag, von großem Segen. In den früher entstandenen Häusern sind die Höfe oft kaum mehr als Lichtschächte, so eng, daß von Luftwechsel und Sonnenschein nicht die Rede sein kann. Jetzt aber sind es wirklich Höfe, die Luft und Licht einlassen. Auch hier spielt sich das Leben eigenartiger ab, als dort, wo ein Pförtner den Zugang bewacht. Eine bekannte und beliebte Erscheinung ist der Leiermann, der zuweilen auch Sänger ist. Mir fallen beide seiner Künste gleich schwer auf die Nerven, doch befinde ich mich entschieden mit meinem schlechten Geschmack in der Minderheit. An Werktagen beginnt der Edle stets mit einem Tanzstück. Kaum sind die ersten Töne, ein Gemisch von Knurren und Jammern, erklungen, so rennen Kinder aus allen Stockwerken herbei und bald ist der Tanz im Schwung. Paarweise reihen sich die Mädchen von den kleinsten an bis zu den zwölf- und dreizehnjährigen. Die Berlinerin der untern Stände beginnt sich früh zu üben, sie tanzt leidenschaftlich gern und nicht selten mit Anmut. Das kann man schon an den Kindern beobachten. Die Knaben springen nur täppisch wie junge Bären nach dem Takte oder ohne ihn zu beachten und schreien dabei, um das Vergnügen zu vergrößern.
Leider taucht der Leiermann auch an Sonntagen auf. Doch nimmt er auf die Feststimmung Rücksicht, denn er beginnt (zwischen 7 und 7 ½ Uhr morgens!) mit einem Choral und geht dann zu einem ernstern Lied über, das den Übergang zu Schottisch und Walzer bildet.
Erfreulicher wirken die Kurrendschüler, die mit einem Lehrer zuweilen erscheinen. Die Knabenstimmen sind oft von wirklicher Schönheit, der Chor klingt voll und rein, das Einsetzen der einzelnen Stimmen beweist erstaunlich gute Schulung.
Zu den musikalischen Genüssen gehören auch die verschiedensten Ausrufe der Händler, die hier in den Höfen ertönen. Am schlichtesten wirkt der „Kohlenfritze“, der sein „Kohlen“ dreimal ruft und „Preßkohlen, Koks, Holz“ hinzufügt, alles auf einen Ton gestimmt. Auch der Lumpenmann, der oft ein Weib ist, und der Scherenschleifer verraten nur geringe musikalische Bildung. Dagegen leistet der Gemüsehändler meistens vortreffliches, da er die verschiedenen Waren mit wechselnder Stimme anzeigt. Zuerst sendet er „Gemüse, Gemüse, Gemüse“ voraus, wovon man nur „Müsemüsemüs“ hört und dann springt er um eine Oktve höher. Besonders das Wort „Salat“ mit langgezogenem zweiten a wird mit Liebe gesungen.
An warmen Abenden sitzen Männer und Frauen in Gruppen beisammen und plaudern und teilen sich Freud und Leid mit. Hier wohnen die Menschen eben näher beisammen und kommen sich deshalb auch gemütlich näher; hier ist das Wort Nachbar nicht nur eine örtliche Bezeichnung und besonders die Frauen helfen sich oft und gern mit kleinen Hilfeleistungen aus. Zu gemeinem Zank kommt es selten, da hier das wirkliche Proletariat nicht anzutreffen ist.
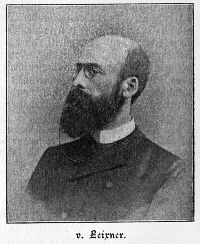 Auch dieses Bild bietet ein Stückchen des echten Berlins, des anonymen, um das sich die Betrachter gewöhnlich nicht kümmern. In anderer Form tritt uns die Idylle im Verborgenen entgegen, nicht selten mit dem Schimmer echter Poesie umkleidet.“
Auch dieses Bild bietet ein Stückchen des echten Berlins, des anonymen, um das sich die Betrachter gewöhnlich nicht kümmern. In anderer Form tritt uns die Idylle im Verborgenen entgegen, nicht selten mit dem Schimmer echter Poesie umkleidet.“
Da hätte Otto von Leixner das „echte Proletariat“ seiner Zeit vermutlich im Beussel- und Rostockerkiez gesucht und seine Empörung über die Unsittlichkeit, sogar „die Pest der weiblichen Bedienung“ läßt uns heute nur schmunzeln. Im oben als Quelle angegebenen Buch beginnt unser Text auf Seite 76. Wir sind im Rahmen des VHS-Kurs der Geschichtswerkstatt Tiergarten zum Wohnungsbau in Moabit auf diesen Text gestoßen und haben ihn dem 8. Kapitel des Standardwerks über „Das Berliner Mietshaus“ von Geist und Kürvers Bd. 2, ab S. 354 entnommen.
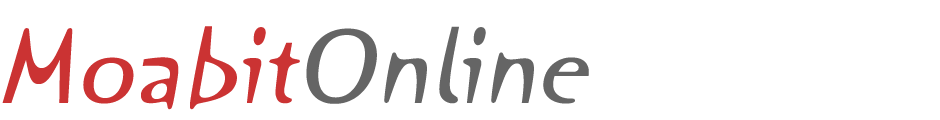



Ich wundere mich, dass noch niemand diesen wunderbaren Artikel kommentiert hat? Ich finde es ist ein ganz herrliches Zeitgemälde und macht mich etwas wehmütig… Was für eine schöne Vorstellung, wenn statt der vielen Autos, die überall parken und sich durch die verengte Straße quetschen, überall Kinder spielen würden 🙂 Danke jedenfalls für diesen Ausflug in die Vergangenheit!