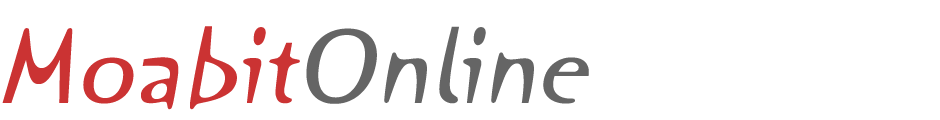Der Professor mit der etwas anderen Mentalität
„Ich will einen Beitrag leisten, der Gegend auf die Beine zu helfen“
 Der Mann denkt langfristig. Das gibt es nicht mehr oft. Gerade da nicht, wo es ums Geschäft geht. Getrieben von der Angst, dass es morgen schon zu spät sein könnte, gilt es allenthalben, den Ertrag schon heute einzufahren. Zwar wird uns auf den Wirtschaftsseiten nicht gerade davon erzählt, wie erfolgreich die Rasereien mit all ihren Überholmanövern auf der Gewinnautobahn sind, doch wird an der Notwendigkeit, jederzeit das maximale Drehmoment des Kapitals zu fahren, trotzdem nicht gezweifelt. Der Mann ist kein Sprinter, sondern Langstreckenläufer. Als solcher kommt er viel herum in der Welt, und wohin er auch reist, er läuft mit offenen Augen.
Der Mann denkt langfristig. Das gibt es nicht mehr oft. Gerade da nicht, wo es ums Geschäft geht. Getrieben von der Angst, dass es morgen schon zu spät sein könnte, gilt es allenthalben, den Ertrag schon heute einzufahren. Zwar wird uns auf den Wirtschaftsseiten nicht gerade davon erzählt, wie erfolgreich die Rasereien mit all ihren Überholmanövern auf der Gewinnautobahn sind, doch wird an der Notwendigkeit, jederzeit das maximale Drehmoment des Kapitals zu fahren, trotzdem nicht gezweifelt. Der Mann ist kein Sprinter, sondern Langstreckenläufer. Als solcher kommt er viel herum in der Welt, und wohin er auch reist, er läuft mit offenen Augen.
Der Mann heißt Professor Wolfgang Maennig und lehrt an der Universität Hamburg Volkswirtschaft. Ein Pendler zwischen Haupt- und Hafenstadt. Im Dezember 2000 hat er das Haus Rostocker Straße 17 in Moabit ersteigert, für 705.000 Mark. Er kannte zwar den Kiez nicht, doch dass es problematisch werden könnte, war ihm klar. Er hat das Haus trotzdem übernommen. Es stand zur Hälfte leer. Und er hat es auch zunächst dabei belassen. Denn, so dachte er, »wenn ich das jetzt vermiete, muss der Bezirk, wenn ich es sanieren will, die Umsetzung der Mieter bezahlen, und diese Kosten könnte man ja sparen.« Der Volkswirt Maennig denkt über seinen Kontoauszug hinaus, und das ist ebenso selten wie langfristiges Denken.
Die Bausubstanz des Hauses sei zwar solide, die Vorbesitzer hätten immer was reingesteckt, Innentoiletten längst installiert, dennoch hätte eine Sanierung vier Millionen Mark gekostet. Es fehlen vor allem die Heizungen, wer in der Rostocker 17 wohnt, muss immer noch Kohlen schleppen. Zwanzig Prozent der Sanierungskosten hätte er aus dem Programm Soziale Stadterneuerung als Zuschuss bekommen. Hätte. Kurz bevor er seinen Antrag einreichen konnte, wurde der Topf zugemacht. Zu spät.
Keinen Kredit für Moabit
Doch Maennig zetert und klagt nicht darüber, er sagt: »Im Grunde ist das schon richtig, dass diese Subventionierung eingestellt wurde, denn ob das eine soziale Sache ist, wenn jemand wie ich 800.000 Mark geschenkt bekommt, weiß ich nicht.« Welch eine bemerkenswerte Mentalität! Und er sagte sich, gut, wenn ich keinen Zuschuss vom Staat bekomme, dann saniere ich eben ohne Zuschuss. Da er aber nirgends vier Millionen herumliegen hat, braucht er für sein Vorhaben einen Kredit.
Die Investitionsbank Berlin, kam ihm zu Ohren, vergibt für Sanierungen Kredite, die zwei Prozent unter den marktüblichen Zinsen liegen. Zunächst dachte er, das sei nur etwas für Wohnungsbaugesellschaften, erfuhr aber auf ausdrückliche Nachfrage, dieses Angebot gelte auch für ihn. Als er das Angebot in Anspruch nehmen wollte, wurde sein Antrag allerdings ohne Begründung abgelehnt.
Nächster Versuch: Eine ganz übliche Bank, ein ganz normaler Kredit. Fehlanzeige. Gibt’s nicht. »Die Banken sind dem Immobilienmarkt gegenüber zur Zeit sehr skeptisch, innerhalb Berlins sind sie noch skeptischer und wenn es um die Bezirke Neukölln, Marzahn und Tiergarten geht, wollen sie gar nicht mehr.« Maennig hat auch in Prenzlauer Berg Häuser, und für die war es kein Problem, Kredite zu bekommen. Es liegt tatsächlich am Bezirk. Die Banken haben es in der Hand, ganze Gegenden in der Stadt abstürzen zu lassen und andere aufzuwerten.
Dabei hat der Mann guten Willen. »Ich finde es spannend, den Wandel mitgestalten zu können.« Natürlich ist das nicht der einzige Grund, warum Maennig Häuser kauft, »natürlich verspreche ich mir auch einen finanziellen Vorteil davon, langfristig jedenfalls. Aber ich will auch einen Beitrag leisten, der Gegend wieder auf die Beine zu helfen.«
Früher interessierte sich der Volkwirt nur für Volkswirtschaft, „ach, was heißt Volkswirtschaft – Weltwirtschaft“. Jetzt ist in ihm auch das Interesse an der Kommunalwirtschaft und -politik erwacht. Er verfolgt die Aktivitäten des Quartiersmanagement, findet die Idee, die Bürger selbst über die Verteilung des einen oder anderen Euro entscheiden zu lassen, gut, und wird ab dem kommenden Frühjahr ein neues Thema lehren, nämlich Immobilienwirtschaft. „Die Zeiten sicherer Preissteigerungen im Immobiliensektor sind vorbei, damit wird die Sache akademisch interessant.“
Mal in die andere Richtung denken
Er fragt sich, ob im Beusselkiez „die Grenze der Integrationsfähigkeit nicht überschritten wurde“. Ein Patentrezept hat er auch nicht, aber vielleicht, sagt er, müsse man mal in die andere Richtung denken. Als er die Marathondistanz durch New York lief, hat er gesehen, dass in dem einen Viertel nur diese und in einem anderen nur jene leben. „Warum soll es in Berlin nicht ein arabisches Viertel geben?“ Es könnte ja eine ganz eigene Attraktivität entwickeln. Ob das die Lösung ist, weiß er auch nicht, aber man könnte die Möglichkeit ja wenigstens mal bedenken. Oder: „Waarum gibt es in Moabit keine türkische Schule? Es gibt in Berlin ein Französisches Gymnasium, die John-F.-Kennedy-Schule, aber keine türkischsprachige.“ Das würde die deutschen Schulen entlasten und die türkischen und arabischen Kinder könnten in ihren Muttersprachen wesentlich besser lernen.
Es wäre noch viel in die andere Richtung zu denken. Doch ein Mentalitätswechsel wird in Berlin nur gefordert. Wolfgang Maennig sieht trotzdem nicht schwarz. „Der Beusselkiez liegt viel zu zentral, als dass er für immer so benachteiligt bleiben könnte. Da wird sich ganz bestimmt noch was tun.“ Der Mann macht Hoffnung. „Ich rede nicht von den nächsten fünf Jahren, eher von zwanzig oder dreißig Jahren.“ Der Mann ist 42 Jahre alt und denkt langfristig.
Text: Burkhard Meise
Zuerst erschienen in stadt.plan.moabit, Nr. 5, Januar 2003