Gedenkort Güterbahnhof Moabit eingeweiht
Etwa 120 Personen nahmen am 16. Juni 2017 an der feierlichen Einweihung des neuen Gedenkorts teil, der an der Ellen-Epstein-Straße zwischen den Parkplätzen vom Hellweg Baumarkt und Lidl Supermarkt liegt. Über 30.000 Juden waren von dort während des Nationalsozialismus in Ghettos und Vernichtungslager in Osteuropa deportiert worden.

Schülerinnen und Schülern der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule gestalten ein würdiges kulturelles Rahmenprogramm zur Einweihung
Zur Einweihung des Gedenkortes gestalteten Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule mit musikalischen Darbietungen eines von Gitarre und Violine begleiteten Chores wie auch durch Lesungen einen würdigen Rahmen für die Redebeiträge von Bezirksstadträtin Sabine Weißler, Prof. Dr. Andreas Nachama, Historiker und Direktor des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors und ehemaliger Vorsitzender (1997-2001) der Jüdischen Gemeinde Berlin, sowie Jan Liesegang und Francesco Apuzzo vom Künstlerkollektiv raumlabor berlin, das im vergangenen Jahr den von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa durchgeführten Kunstwettbewerb zur Gestaltung des Gedenkortes gewonnen hatte.
20 Waldkiefern wurden auf der für den Gedenkort verbliebenen – gerade mal 250 Quadratmeter großen – Fläche gepflanzt. Sie stehen dicht, bilden ein scheinbar deplatziertes Element eines Kiefernwaldes und sollen in dem unwirtlichen Raumzusammenhang für Irritation sorgen. Die Stämme der Kiefern, die schon jetzt eine stattliche Höhe aufweisen, sind mit einem Kalkanstrich geweißt – Schülerinnen und Schüler der benachbarten Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule begleiteten die Entstehung des Gedenkortes sowohl mit der Auseinandersetzung mit der Geschichte wie auch mit der Beteiligung am Kalkanstrich. Die Kronen der eng gepflanzten Kiefern bilden schon jetzt die Basis für ein lichtes Dach. Aber nicht nur mit den Augen sehen kann man die Kiefern, sie sprechen auch den Geruchssinn an, eine weitere Irritation in dieser Umgebung, die zur Auseinandersetzung mit dem Ort anregt und zum Verweilen einlädt, z.B. auf einer kleinen steinernen Sitzfläche am Rand zur Ellen-Epstein-Straße, wahlweise mit dem Blick zu den jenseits der Straße gelegenen Gleisen vom Nordring oder durch den Kiefernhain zum Fragment des Deportationsgleises, der historischen Spundwand und dem historischen Stück des Pflasterweges vom Gleisfragment zur Quitzowstraße.
Nach 30 Jahren werden die Kiefern eine Höhe von 30–35 Metern erreichen – ein wachsender, lebender Gedenkort, der mit den Jahren seine Gestalt verändert – im Gegensatz zu Gedenkorten aus totem Material, stellt Francesco Apuzzo heraus. Der neue Gedenkort versteht sich als Spiegelung des Mahnmals an der Levetzowstraße. Die Gedenkstätte Levetzowstraße – von der als Sammellager missbrauchten Synagoge wurden die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger durch die Moabiter Straßen zur Deportationsrampe verbracht – bleibt das zentrale Moabiter Mahnmal neben dem Denkmal auf der Putlitzbrücke und dem neuen Gedenkort.

Die Stele an der Quitzowstraße visualisiert den Weg vom Sammellager durch Moabit zu den Deportationsgleisen
Eine Skizze auf dem Ende des historischen Pflasterweges an der Quitzowstraße visualisiert anschaulich den Deportationsweg vom Sammellager durch Moabit an diesen Ort. Eine zweite Stele an der Quitzowstraße zeigt in einer Skizze die Lage der für die Deportationen benutzten Militärgleise 69, 81 und 82 des ehemaligen Güterbahnhofs Moabit.
Seit 25 Jahren weisen zahlreiche Einzelpersonen, Initiativen, die Gedenkstätte Topographie des Terrors auf die Wichtigkeit dieses Ortes hin, seit Mitte der 1990er Jahre war das damalige Bezirksamt Tiergarten mit den früheren Bahntöchtern VIVICO und DB Netz im Gespräch. Was die Verfasser des Entwurfs für den neuen Gedenkort 2016 bei ihrem ersten Besuch des Ortes vorfanden, empfanden sie wie eine „… Inszenierung eines bitterbösen Kunstwerkes. Klarer, banaler, zynischer kann man das systematische Wegsehen, welches genau an diesem Ort vor 75 Jahren stattgefunden hat, nicht reinszenieren. Die völlige Abwesenheit von Empathie macht betroffen, traurig und ratlos.“
Sabine Weißler wies wie schon anlässlich der Vorstellung des Wettbewerbsergebnisses im September 2016 kritisch auf die Planungsgeschichte hin, die vom Grundstückverwertungsdruck geprägt war. Prof. Andreas Nachama zitierte aus den Erinnerungen von Hildegard Henschel (1897–1983), der Ehefrau des damaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin zu den Umständen und Erlebnissen der von Deportationen Betroffenen und Angehörigen.
Seit 25 Jahren haben sich Einzelpersonen, Initiativen, die Topographie des Terrors sowie Verwaltungen von Bezirk und Senat in immer wieder neuen Konstellationen um die Errichtung dieses Gedenkorts als Ergänzung zu den 1987/88 errichteten Mahnmalen an der Levetzowstraße und auf der Putlitzbrücke befasst. In den Redebeiträgen besonders gewürdigt wurden die Verdienste des 2015 verstorbenen Historikers Alfred Gottwald, der insbesondere zur Deutschen Reichsbahn und der Zeit des Nationalsozialismus geforscht hat, und erstmals 2006 in einer Veröffentlichung nachwies, dass vom Güterbahnhof Moabit aus die meisten Deportationen aus Berlin erfolgten, die Verdienste von Andreas Szagun, ehemaliger Eisenbahner der sich in verschiedenen Initiativen engagiert und als Hobbyhistoriker wichtige Beiträge zur Eisenbahngeschichte verfasst hat und von Thomas Abel als Mitglied der 2011 gegründeten Moabiter Initiative „Sie waren Nachbarn“.
Mit der Einweihung des Gedenkorts Güterbahnhof ist aber nicht nur eine Mahnung zum Gedenken an die Geschichte der Deportationen verknüpft, sondern auch eine Mahnung an einen anderen Umgang mit diesem Ort – nicht nur ein wachsender, lebender Gedenkort, der mit den Jahren seine Gestalt verändert – sondern auch Pflege und Aufmerksamkeit braucht, was Francesco Apuzzo vom raumlabor berlin in seinem Redebeitrag betonte – eine Herausforderung sowohl an die für den Ort zuständigen Verwaltungen des Landes Berlin bzw. des Bezirks Mitte wie auch an unsere Gesellschaft. Die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule äußerte schon, dass sie als direkter Nachbar mit auf den Gedenkort achten und als Thema im Unterricht aufnehmen wird. Und die Bitte von Frau Weißler am Ende der Veranstaltung: „Passen Sie auf diesen Ort auf!“ wird hoffentlich nicht vergeblich sein, und Einzelpersonen wie Initiativen werden den wachsenden Gedenkort aktiv – und wenn notwendig auch die Ämter mahnend – begleiten.
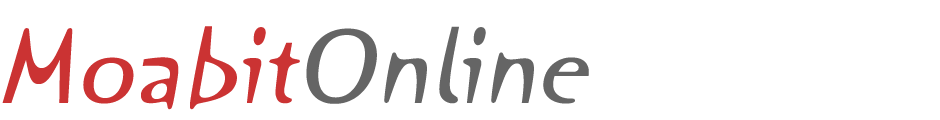




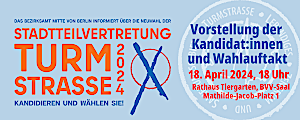
Bericht auf RBB Aktuellvon der Einweihung
Schlimme Erfahrungen der Gruppe von Jugendlichen, der AG Erinnern der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, die sich so berührend bei der Einweihung des Gedenkorts beteiligt hat, bei ihrer Polenreise:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/theodor-heuss-schule-in-moabit-berliner-schueler-in-polen-rassistisch-beleidigt/19985282.html
Berichte der Reisen nach Israel und Frankreich/Spanien sind hier verlinkt:
https://moabitonline.de/26651#comment-35094
Hier noch ein Link zu Erinnerungs-Aktivitäten der Theodor-Heuss-Schule:
http://thgberlin.de/thg-spezial/ein-zeitzeuge-des-holocaust-im-gespraech-dr-leon-weintraub/
… und ein kritischer Blick auf den neuen Gedenkort und eine Mahnung zur Kennzeichnung des Weges:
http://www.graswurzel.net/423/rampe.php
zu 3, zweiter Absatz (Link zum Artikel der „Graswurzelrevolution“)
Der „kritische Blick auf den neuen Gedenkort“ stellt einiges falsch dar, daher hier eine Zeittafel:
1987: Einweihung des Mahnmals auf der Putlitzbrücke
1995: Abriß der charakteristischen Unterführung zwecks Abriß der abgängigen Ringbahnbrücken
1996: FNP-Änderungsverfahren bezüglich der „Nordstraße“ (Ellen-Epstein-Straße und deren Fortsetzung zur Beusselbr.)
1996: Heimatmuseum Tiergarten beschäftigt sich mit der tatsächlichen Lage der Deportationsgleise, das BA fragt beim Heimatmuseum nach Daten und Bildern zum Thema Deportationsrampe nach
1998: BA Tiergarten beschließt Aufstellung von B-Plänen für die gesamte „Bahnlinse“, also die Blöcke 9 und 901. Dieses Gebiet wird in Einzelplänen II-183 bis II-189 unterteilt und reicht von der Perleberger Brücke bis zur Beusselbrücke. Der damalige Baustadtrat Porath drängt darauf, daß erhaltene Teile des Deportationsortes nicht der Vernichtung anheimfallen dürfen. Auf der für alle Pläne zusammengefaßten Erörterungsveranstaltung im Rahmen des B-Plan-Verfahrens äußert sich ein Vertreter der Bahn dahingehend, daß sich die Bahn selbstverständlich ihrer historischen Verantwortung stellen wolle
1999: Die damalige Grundstückseigentümerin Vivico bestellt ein Gutachten zum Deportationsort bei Herrn Dr. Spielmann
2000: Gutachten wird dem Auftraggeber, aber angeblich nicht dem BA, geliefert (das soll erst 2004 geschehen sein)
2001: Weitere Abrisse im Rahmen der Bauarbeiten für den Zentralbahnhof, unter anderem Gleise 82 und 81
2002: Bitte des BA, StaplA, an einen fachkundigen Moabiter Bürger, Fragen zur tatsächlichen Lage der Deportationsgleise zu beantworten, da das von der Vivico bestellte Gutachten noch nicht vorläge
2003: Vorbereitung eines Verfahrens zur Unterschutzstellung des Bereiches der noch erhaltenen historischen Anlagen einschließlich des Zufahrtsweges durch das Landesdenkmalamt
2005: B-Plan für einen Baumarkt
2006: Einberufung eines Runden Tisches zum geplanten Gedenkort, federführend betreut durch die Stiftung Topographie des Terrors
2006: Im Rahmen des Runden Tisches Beauftragung eines Gutachtens von Gottwaldt, Schulle und Dettmer; wichtigstes Ergebnis: Nicht wie bisher angenommen der Gbf Grunewald, sondern der Gbf Moabit war der Hauptabgangsbahnhof für Deportationszüge aus Berlin, mit einer ermittelten Zahl von etwa 32000 Deportierten
2007: Einweihung der (provisorischen) Gedenkstele auf der Quitzowstraße
Im Rahmen der Vereinbarungen mit den Investoren für das Baumarktgelände wird der geplante Gedenkort bautechnisch gefaßt (Stützwände, Entwässerung, Reparatur des gepflasterten Originalweges), als Ausgleichsmaßnahme für die Ellen-Epstein-Straße wird der „Deportationsweg“ bis an die Straße verlängert und mit Bäumen ausgestattet (die später nicht gewässert werden und daher teilweise absterben).
2010: BVV Mitte beschließt, daß sich das Bezirksamt Mitte für die Gestaltung eines Gedenkortes einsetzen soll (DRS 1591 / III)
2011: Vorlage zur Kenntnisnahme bezüglich des BVV-Beschlusses zur DRS 1591 / III
2013: Fachgespräch im BA Mitte /Kultur wegen Gestaltung des Mahnortes einschließlich ausführlichem Vortrag über die historische Bedeutung des Ortes
2013: BVV Mitte beschließt, daß das Bezirksamt sich dafür einsetzen soll, einen Wettbewerb zur Gestaltung des Gedenkortes auszuloben (DRS 1090 / IV, Bezug zum Antrag von 2010)
2014/2015: Dr. Alfred Gottwaldt erarbeitet ein neues Buch zur Deportationsrampe, das u.a. auch die Ergebnisse des Gutachtens von Gottwaldt, Schulle und Dettmer einer breiten Öffnetlichkeit vorstellt
2015: Übertragung der Flurstücke 287, 359 und 360 ins Eigentum des Landes Berlin. Dabei ist versehentlich der Grundstücksstreifen von der Parkplatzstützmauer und der originalen Rampe (einschließlich) weiterhin Grundstück des Verbrauchermarktes geblieben, die Instandhaltungspflicht liegt bei diesem (Flurstück 259)
2015: Bereitstellung von Lottomitteln für die Gestaltung eines Gedenkortes
2016: Eintragung des Weges und des Gedenkortes sowie des Bereiches vor der der ehemaligen Militärrampe (Deportationsrampe) in das Denkmalverzeichnis des Landes Berlin (Objekt Nr. 09097814, Flurstücke 287, 366 und 367). Das Rampenbauwerk bildet dabei die Grundstücksgrenze, so daß auch hier die Instandsetzungspflicht bei den Eignern der Flurstücke 275, 269, 254 und 259 liegt
2016: Auslobung, Durchführung und Entscheid des Gestaltungswettbewerbs für die Gestaltung des Gedenkorts
2017: Gestaltung und Einweihung des Gedenkortes
Dabei sollte eines nie aus dem Auge verloren werden: Als man sich im Bezirk erstmals mit dem heutigen Gedenkort befaßt hatte (und das vor zwanzig Jahren!), galt dieser Ort als einer von mehreren in Berlin, aber nie als der wichtigste. Als sich dies herausgestellt hatte (2006), waren wesentliche Teile der originalen Bausubstanz (u.a. die Gleise 82 und 81) schon durch die neuen Verkehrsanlagen der Bahn sowie durch erfolgte Grundstücksverkäufe beseitigt, bzw. von Beseitigung bedroht. Vor zwanzig Jahren gab es sogar die Meinung, daß für einen eher untergeordneten Ort das Mahnmal auf der Putlitzbrücke ausreichend wäre.
Lichtinstallation und Forderung:
https://www.berliner-woche.de/moabit/c-kultur/licht-gegen-dunkelheit_a250663
Da leider derzeit eine sehr merkwürdige Aktion von Seiten des Vereins „Gleis 69 e.V.“ läuft, die auch Einfluß auf die BVV hatte, hier ein Artikel auf Moabit.Net mit Verweis auf den Leserbrief an den Tagespiegel, der leider in diesem Falle schon mehrfach nicht besonders sorgfältig recherchiert hatte:
https://www.moabit.net/14480
Um den Leserbrief an den Tagesspiegel eines Mitglieds der Inintiative „Ihr letzter Weg“ einzuordnen – hier ein paar Links:
Presseerklärung Gleis 69 zu Lidl und Gedenkort vom 20.5.21
https://gleis69.de/presseerklaerung-zu-lidls-bauplaenen-auf-der-denkmalgeschuetzten-deportationsrampe
In diesem Zusammenhang ist es auch erhellend den Kommentar Nr. 4 zu beachten.
Mündliche Anfrage der Grünen vom 21.5.
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=10715
Dringlichkeitsantrag der FDP vom 25.5.
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=10722
Mündliche Anfrage der CDU vom 25.5.
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=10720
Tsp. vom 28.5.21 (die frühere Veröffentlichung wurden angepasst, so dass der Text, auf den sich der Leserbrief konkret bezieht, nicht mehr online zu finden ist)
https://www.tagesspiegel.de/berlin/parkplatzerweiterung-auf-deportationsrampe-berliner-lidl-plant-neubau-am-rand-eines-mahnmals/27227924.html
Der geänderte Artikel des Tagesspiegel ist für mich Anlaß, einiges anzumerken:
Empört wird von den „jetzt bekannt gewordenen Baupläne[n], die die Firma Lidl auf der denkmalgeschützten Deportationsrampe verfolgt“, in der Presseerklärung des Vereins „Gleis 69 e.V. geredet. Der Tagesspiegel setzte (Ausdruck vom 28.05.2021) nach mit folgender Formulierung: „Ein Bauantrag dafür ist am 9. November 2020 gestellt worden – also am Jahrestag der Reichspogromnacht. An jenem Tag im Jahr 1938 brannten in Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte. Nazi-Schlägertrupps misshandelten, verhafteten und töteten Tausende Juden.“
Die Empörung könnte man ja verstehen, wenn es nicht ein paar weitere, wichtige Fakten gäbe: Der Bebauungsplan ist erstmals Mitte der 90er Jahre aufgestellt worden, in der Begründung zum aktuell laufenden Verfahren wird dargelegt, welche Gründe zur Verzögerung im Verfahren geführt haben. Die Grundintentionen sind jedoch ähnlich: „Somit ist vor dem Hintergrund eines weiter wachsenden Entwicklungsdrucks eine geordnete städtebauliche Entwicklung, die der Lage der Flächen im Stadtteil und der Umgebung sowie dem bezirklichen Ziel der Entwicklung und Sicherung kleinteiligen Gewerbes und Handwerks entspricht, nicht hinreichend sichergestellt“ (Seite 5) bzw. „Mit dem Bebauungsplan wird eine Angebotsplanung erstellt, mit der aus städtebaulichen Gründen einzelne in einem Gewerbegebiet (GE) allgemein bzw. ausnahmsweise zulässige Nutzungen ausgeschlossen werden (siehe 3.1.2 und 3.1.3). Der Standort eines Einzelhandelsbetriebes, der gemäß bezirklichem Zentren- und Einzelhandelskonzept für die Nahversorgung relevant ist, soll jedoch gesichert werden.“ (Seite 33).
Die Auslegung im Verfahrensschritt „Frühzeitige Bürgerbeteiligung“ ist zwischen dem 10. Oktober und dem 19. November 2021 erfolgt – der „Bauantrag“ vom 9. November ist also in dieser Frist gestellt worden. Ist er nicht, denn der zuständige Stadtrat, Ephraim Gothe, hat in der BVV klargestellt, daß es sich um eine Bauvoranfrage gehandelt hätte. Auch wenn man die Firma Lidl nicht mag, so muß man ihr doch das Recht, das jeder Bürger und damit auch jeder betroffene Eigentümer hat, zubilligen, mittels dieses Schrittes zu prüfen, inwieweit eigene Interessen davon betroffen sein könnten. Und da zeigt der Text zur Begründung klare Linien auf: „Textliche Festsetzung Nr. 1: Einschränkung von Einzelhandelsbetrieben und Läden Im GE 1 sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig.“ (Seite 33). Mit GE 1 ist die Fläche westlich der Grundstücksgrenze des bestehenden Verbrauchermarktes gemeint, also auch das vom Tagesspiegel erwähnte Flurstück 254: „Ein Teil der Rampe könnte verschwinden. Außerdem zeigt die Planung, dass ein zusätzliches, ebenfalls denkmalgeschütztes Flurstück (Nr. 254) größtenteils überbaut werden soll. Damit würde ein weiterer Teil der früheren Rampe, die jetzt noch als ein etwa 140 Meter langes Teilstück erkennbar ist, verschwinden.“ Liest man jedoch die Bebauungsplanbegründung, so findet man folgende Formulierungen: „Der an der Ellen-Epstein-Straße befindliche Gedenkort wird in seiner derzeitigen Ausprägung planungsrechtlich gesichert. Das dazugehörige Flächendenkmal wird nachrichtlich übernommen.“ (Seite 32). Weiter heißt es: „Am Eingang des Gedenkweges in der Quitzowstraße befindet sich eine Informationstafel, am Ende des Gedenkweges an der Ellen-Epstein-Straße wurde auf einer Teilfläche des Flächendenkmals ein Gedenkort angelegt. Die Flächen des Weges und des als Gedenkort gestalteten Bereiches sind als ‚Flächen für den Gemeinbedarf‘ festgesetzt. Diejenigen Flächen der Gesamtanlage, die (noch) nicht als Denkmal entwickelt wurden, werden nachrichtlich übernommen und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB mithilfe einer ‚Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen‘ gekennzeichnet. Diese Flächen liegen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, um der weiteren Entwicklung des Denkmals nicht entgegenzustehen. (vgl. Kap. III 3.3 Flächen für Gemeinbedarf)“ (Seite 43). Mit diesem Text, der zeitlich vor dem „Bauantrag“ formuliert worden ist, sollte klar sein, daß die Interessen des Bezirks andere sind als die Interessen von Lidl – und daß der Denkmalschutz als wichtiges Ziel festgeschrieben wird. Die Äußerungen in der BVV von Stadtrat Gothe zu einer möglichen Übernahme durch das Land lassen hoffen. Allerdings muß hier klar das Land seine Verantwortung übernehmen, denn der Güterbahnhof Moabit hat sich als eine Stätte stadtweiter Wirkung herausgestellt (Gutachten von Gottwaldt,/Schulle/Dettmer), deren Erhalt und Entwicklung man nicht einfach einem Bezirk überhelfen bzw. ihn damit alleinlassen darf. Ich habe da persönlich den Eindruck, daß da bei dem einen oder anderen Entscheidungsträger immer noch die längst überholte Meinung vorherrscht, daß Moabit nur einer von vielen Deportationsorten Berlins gewesen sei.
Natürlich muß man sich jetzt Gedanken über diesen Geländestreifen an der Ellen-Epstein-Straße machen, denn als originale Substanz ist nur noch die bauliche Einfassung der ehemaligen Militärrampe anzusehen. Das dazugehörige Gleis ist schon im Rahmen der Baumaßnahmen für den Zentralbahnhof beseitigt und durch ein neues ersetzt worden, das als temporäre Strecke vom Containerbahnhof zum Güterbahnhof Moabit gedient hatte. Auch dieses temporäre Gleis ist nach Beendigung seiner Nutzung wieder beseitigt worden. Ob die Betonplatteneindeckung nicht eher eine Nachkriegszutat ist, muß noch geklärt werden, ebenso die bauliche und gestalterische Verbindung mit dem schon existierenden Gedenkort. Hier wären ja sowohl eine Duplizierung des schon realisierten Entwurfs „Hain“ von Raumlabor als auch ein weiterer künstlerischer Wettbewerb für eine ganz andere Gestaltung denkbar. Vielleicht könnte man auch, aber das wäre das Schwierigste daran, die Geschichte vom „vergessenen“, weil lange in seiner Wichtigkeit verkannten, Ort zu seiner heute erkannten historischen Bedeutung aufzeigen.
Alles in allem läßt sich sagen: Das war ein Sturm im Wasserglas. Von jemandem, der einen Doktortitel trägt und bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf sein Bundesverdienstkreuz hinweisen läßt, sollte man verlangen können, daß er einen Begründungstext zu einem Bebauungsplanverfahren lesen und ihn auch zeitlich einordnen kann. Auch die detaillierte Kenntnis des fast zwanzigjährigen Weges zu einem Gedenkort wären sicherlich hilfreich. Viele der konstruierten Anwürfe hätten sich dann von vornherein erübrigt. Bei einem unklar erscheinenden „Antrag“ der Firma Lidl hätte es auch eine sachlich formulierte Bürgeranfrage getan. Aber da das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist: Vielleicht kann ja das Bezirksamt hier im Forum eine – soweit das datenschutzrechtlich zulässig ist – Auskunft über das angefragte Bauvorhaben geben.
Hallo Andreas:“ist zwischen dem 10. Oktober und dem 19. November 2021 erfolgt“( 3. Abschnitt, 2. Zeile):
ich vermute 2020
@Martin:
Stimmt!
Hier ist die schriftliche Beantwortung der Mündlichen Anfrage der CDU, die in der Mai-BVV aus Zeitgründen nicht beantwortet werden konnte:
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=10720
dann auf der rechten Seite bei „Anlagen“ auf „2. Antwort vom 21.06.2021“ klicken.
Am Sonntag, 5.9. 18-20 Uhr wird das dauerhafte Lichtzeichen auf dem Gedenkort Güterbahnhof Moabit eingeweiht und die Publikation „Systematik der Deportationen“ des Amts für Weiterbildung und Kultur vorgestellt (bitte bis 3.9. anmelden!):
https://moabitonline.de/wp-content/uploads/2021/08/Lichtzeichen_2021-09-05.pdf
Tagesspiegel zur gestrigen Gedenkveranstaltung der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule:
https://www.tagesspiegel.de/berlin/gedenken-an-die-pogromnacht-in-berlin-innehalten-inmitten-von-baulaerm-am-gueterbahnhof-moabit/27783568.html