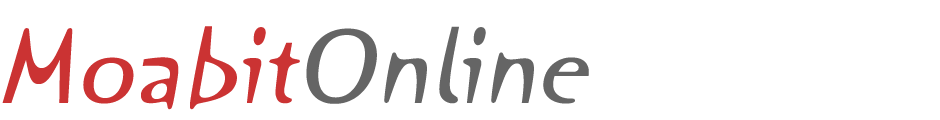„Männerhemden zum Kragenwenden“
Wie war der Stephankiez? -Kiezbewohnerinnen haben viel zu Erzählen
 Mitte Januar, Erzählnachmittag im Betroffenenratsladen. Merkwürdiges und Bekanntes rund um die Perleberger Straße, Quitzowstraße, Stephanstraße und Birkenstraße über Menschen und Geschäfte von Früher und Heute berichteten langjährige Stephankiezbewohner-innen. Mit großem Interesse fragten die Neuzugezogenen nach markanten Einschnitten in der Geschichte: „Sind nach dem Mauerfall nicht viele Ostberliner in den Westen gezogen?“ Das wollte niemand bestätigen: „Nein, es war eher umgekehrt.“ Aber aus dem Stephankiez sind schon in den 70er Jahren viele weggezogen, in grünere Außenbezirke, nach Lankwitz zum Beispiel. Manchmal ging es etwas durcheinander und zerfaserte in unstrukturierte Nebengespräche:“Wo war das denn genau?“ Doch konnte der Erzählfaden immer wieder neu aufgenommen werden. Hier sind einige Erzählschnipsel gesammelt.
Mitte Januar, Erzählnachmittag im Betroffenenratsladen. Merkwürdiges und Bekanntes rund um die Perleberger Straße, Quitzowstraße, Stephanstraße und Birkenstraße über Menschen und Geschäfte von Früher und Heute berichteten langjährige Stephankiezbewohner-innen. Mit großem Interesse fragten die Neuzugezogenen nach markanten Einschnitten in der Geschichte: „Sind nach dem Mauerfall nicht viele Ostberliner in den Westen gezogen?“ Das wollte niemand bestätigen: „Nein, es war eher umgekehrt.“ Aber aus dem Stephankiez sind schon in den 70er Jahren viele weggezogen, in grünere Außenbezirke, nach Lankwitz zum Beispiel. Manchmal ging es etwas durcheinander und zerfaserte in unstrukturierte Nebengespräche:“Wo war das denn genau?“ Doch konnte der Erzählfaden immer wieder neu aufgenommen werden. Hier sind einige Erzählschnipsel gesammelt.
H.N.: Kein Kindertrauma – die Nachkriegszeit
In der Havelberger Straße bin ich nach dem Krieg aufgewachsen, mein erstes Schuljahr hier am Stephanplatz in die Schule gegangen und dann in die Siemensstraße gewechselt, in die heutige James-Krüss-Gundschule. Mit meinen Freundinnen habe ich immer in den Ruinen gespielt. Es ist erstaunlich, wie selbstverständlich für Kinder ihre Lebensumstände sind. In meiner Erinnerung gibt es kein Kriegstrauma, im Gegenteil unsere Spiele in den Ruinen waren wunderbar. Auch die zerstörten Häuser, die noch standen und bewohnt wurden. Neugierig betrachtete ich die Zimmer, denen eine Wand fehlte, die Möbel standen noch und die Leute hingen ihre Wäsche auf. Irgendwie hat es mir gefallen.
H.N.: Kennen Sie noch die Leihbüchereien? 
Können Sie sich noch an die Leihbüchereien erinnern? Meine Mutter hat mich immer mitgenommen in die Wilsnacker Straße. Dort hatten zwei alte Damen eine Leihbücherei. Von den Ausleihgebühren lebten sie. Das war irgendwann in den 50ern. Ich wurde auf einem Plüschhocker deponiert, wenn meine Mutter ihre Lektüre aussuchte. „Darf es auch etwas Anspruchsvolles sein?“ war die Standardfrage. Ich saß dann da und schaute mir alle anderen Besucherinnen an. Zu dieser Zeit gab es noch keine schönen Kleidungsstücke zu kaufen. So zog ich in meiner Phantasie den anderen Leserinnen jeweils ihr schönstes Kleidungsstück aus und meiner Mutter an: ein paar schöne Schuhe, einen auffallenden Hut oder einen warmen Mantel. Später kam der Bertelsmann Buchclub auf, dann gab es diese Leihbücherein nicht mehr.
B.N.: In jedem Haus gab es einen Laden
In den Stephankiez eingezogen bin ich kurz nach meiner Heirat. Eigentlich bin ich ein Flämingskind, hatte in Johannisthal gewohnt und war eine der letzten, die legal nach ungeheurem Behördenkrampf in den Westen ziehen konnte. Nach dem Mauerbau habe ich meinen Vater nicht mehr wiedergesehen. Im November 1959 war das Haus fertig, ein Nachkriegsneubau. Schräg gegenüber in der Stephanstraße 16 wohnten meine Schwiegereltern in einem Altbau. Da gab es große herrschaftliche Wohnungen und auch noch Leute mit Dienstmädchen. Unten war das Polizeirevier, das dann später in einen Flachbau am Stephanplatz umzog – dort steht jetzt der Neubau mit dem Pennyladen. Unser Haus wurde am Anfang noch mit einer Kohleheizung befeuert. Es gab einen Angestellten, der dafür sorgte, das der Ofen im Keller brannte. Später wurde das dann auf Öl umgestellt. Erst vor wenigen Jahren sind wir an die Fernwärme angeschlossen worden. Es gab hier alles in nächster Nähe einzukaufen, in jedem Haus einen Laden: Drogerie, Meyers, Bäckerei Riedel, Schlachter, Zigarren Lehmann, Kolonialwarenläden. Wenn man was vergessen hatte und das Geschäft war schon geschlossen, kannte man ja die Leute, die oft hinter dem Laden wohnten, konnte klopfen und noch schnell was holen. Gegenüber gab es einen Tante Emma Laden mit Wäsche, Knöpfen und so weiter. Hier bei Mutter Weiland hing das Schild „Männerhemden zum Kragenwenden“. Aus dem Rücken wurde Stoff geschnitten und vorne eingesetzt.
E.G.: Eine gute Wohngegend
1962 bin ich in die Stephanstraße eingezogen. Eigentlich wollte ich gerne eine 1-Zimmer-Wohnung gegenüber der Paech-Brot-Fabrik bekommen, für 78 DM Miete mit Balkon. Dort wohnte eine Freundin. Aber das hat leider nicht geklappt. Es war eine gute Wohngegend mit so vielen wunderbaren Geschäften. Kurz nachdem ich eingezogen war, hatte ich meine gekaufte Wurst in einem Kolonialwarengeschäft liegengelassen. Und ich war noch nicht lange zu Hause, da klingelte es an der Tür und sie brachten das Wurstpäckchen. Komischerweise hab ich mich darüber gar nicht gefreut, sondern war ärgerlich, dass die schon wussten, wo ich wohnte. Aber über die Wäscherei gegenüber war ich sehr erfreut, denn man hat ja noch mit dem Waschbrett und dem Kochtopf auf dem Herd gewaschen. Ich habe mich hier immer wohlgefühlt. Doch nach und nach haben immer mehr kleine Geschäfte zugemacht. Viele aus Altersgründen, deren Kinder wollten die Läden nicht weiterführen. Es kamen auch die ersten Supermärkte – Bolle. Als das Kaffeegeschäft Stephan-Ecke Rathenower Straße zumachte – heute ist dort das Restaurant Bukarest – wollte ich mich an keinen neuen Kaffeegeschmack gewöhnen. Es hat mir keiner mehr so gut geschmeckt. Irgendwann wurde die Stephanstraße umgebaut und der Gehweg schmaler, damit mehr Autos parken konnten. Das war nicht gut. Jetzt habe ich Angst vor den Radfahrern.
U.G.: 22 Jahre bei Paech-Brot gearbeitet 
Ich bin erst 1970 mit meinem Mann und 2 kleinen Kindern eingezogen, gegenüber der Paech-Brot-Fabrik in die Stephanstraße. Meine Kinder waren damals 3 und 5 Jahre alt. Ich war 5 Jahre zu Hause gewesen. Jetzt kam ich an dem Plakat vorbei, dass Paech Arbeitskräfte suchte und wollte gerne als Putzfrau anfangen. Doch sie hatten nur was als Packerin, von 5 Uhr früh bis um 9 Uhr. Das hab ich dann gemacht, im April sind wir eingezogen und schon am 1. Juni fing ich meine Arbeit an. Jeden Morgen um halb 4 aufstehen. 22 Jahre hab ich bei Paech-Brot gearbeitet. Nach dem Mauerfall war dann der Ofen aus, die Firma ist nach Bernau gezogen, jetzt als Lieken-Brot. Ich hätte dort weiterarbeiten können. Aber für 5 Arbeitsstunden diesen weiten Weg. Das wollte ich nicht. Es war schon ein eigenartiges Gefühl jetzt mitanzusehen, wie das alles jetzt abgerissen wurde.
zuerst gedruckt in: stadt.plan.moabit, Nr. 26, Februar 2005
Fotos: Christoph Eckelt (bildmitte.de)